
Die Entwicklung von Konstanz zur „kleinen Großstadt“ hat auch dazu geführt, dass sich soziale Problemlagen zugespitzt haben. Daraus resultieren zusätzliche Bedarfe für die Jugendhilfe insgesamt. Die Schulsozialarbeit kann Überforderung von Familien frühzeitig wahrnehmen und bildet eine Brücke zum Jugendamt. Seit Corona haben psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen deutlich zugenommen.
seemoz hat ein Gespräch mit für die Schulsozialarbeit Verantwortlichen im Sozial- und Jugendamt der Stadt Konstanz geführt. Markus Schubert ist stellvertretender Amtsleiter sowie Abteilungsleiter „Soziale Dienste“. Christine Moll betreut als Elternzeitvertretung das Sachgebiet „Schulsozialarbeit“ bei der Stadt und ist als Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule Lotte Eckener tätig.
Beide blicken zunächst auf die Geschichte der Schulsozialarbeit in Konstanz zurück. Sie wurde 2001 in bescheidenem Umgang zunächst an zwei damaligen Grund- und Hauptschulen eingeführt. Dies geschah in einem negativen Kontext. Man sprach von „Brennpunktschulen“, an denen Schulsozialarbeit quasi in einer Ausnahmesituation notwendig sei. In der Folgezeit wurde die Schulsozialarbeit auf alle Konstanzer Schulen ausgeweitet, heute ist sie am Lern- und Lebensort Schule selbstverständlich. Historisch wurde insbesondere das Erfordernis von Schulsozialarbeit an Gymnasien in Frage gestellt. Markus Schubert stellt klar, dass die Gymnasien heute als „Hauptschulen“ im Wortsinn einzuordnen sind, die von der Mehrheit der Schüler*innen im Sekundarbereich besucht werden. Naturgemäß ergeben sich auch dort Herausforderungen wie Mobbing und Drogenkonsum.
Einzelhilfe und Angebote in Schulklassen
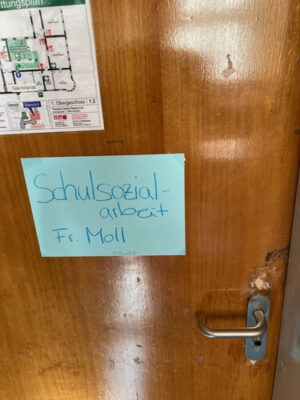
Die Schulsozialarbeit bietet zum einen Einzelhilfe und Beratung bei individuellen Problemlagen an und leistet zum anderen gruppenbezogene sozialpädagogische Arbeit mit Schulklassen. Sie wendet sich gemäß gesetzlichem Auftrag an „sozial benachteiligte oder in ihrer individuellen Entwicklung benachteiligte junge Menschen“ – ist also zunächst kein Unterstützungssystem für Schulen und Lehrkräfte. „Die Schulsozialarbeit ist keine Autoreparaturwerkstatt“, sagt Markus Schubert. Kooperation und Rollenklärung zwischen Lehrer*innen und Fachkräften der Schulsozialarbeit haben sich über die Jahre deutlich verbessert.
Die Corona-Schutzmaßnahmen haben zu einer enormen psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen geführt. Dies ist heute immer noch deutlich spürbar, die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Schüler*innen ist sehr hoch. Christine Moll berichtet von einer „superlangen Wartezeit“ für stationäre und ambulante Jugendpsychiatrie. Wenn keine Suizidgefahr besteht, müssen Betroffene ein halbes oder gar ein Dreivierteljahr auf einen angemessenen Therapieplatz warten. „Schulsozialarbeit fängt vieles auf“, sagt sie. Es geht hier um eine Stabilisierung im Übergang zu einer psychotherapeutischen Behandlung, keinesfalls kann Schulsozialarbeit Psychotherapie ersetzen.
Umfang der Schulsozialarbeit in der Verantwortung der Stadt
Während die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften in ausschließlicher Zuständigkeit des Landes liegt, entscheiden die Kommunen selbst über den Umfang der Schulsozialarbeit. In Konstanz gilt ein Schlüssel, der nach Schularten differenziert. An der Werkrealschule soll es für 250 Schüler*innen eine Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit geben, an Gemeinschaftsschulen und Realschulen sind es jeweils 350, an Grundschulen 450 sowie an Gymnasien 900 Schüler*innen. Dieser Schlüssel basiert nicht auf einer Vorgabe des Landes, sondern wurde in Konstanz entwickelt und immer wieder angepasst. Es wird versucht, die unterschiedlich starke Belastung der Schularten aufgrund des sozio-ökonomischen Hintergrunds der Schüler*innen zu berücksichtigen.
Über die Regeln der Personalbemessung entscheidet der Gemeinderat, die konkrete Einrichtung von Stellen auf dieser Grundlage liegt dann in der Verantwortung der Stadtverwaltung. Derzeit gibt es in Konstanz insgesamt 16,8 Stellen. Das Land Baden-Württemberg übernimmt ein Fünftel der Kosten, was viel zu wenig ist. Bei der Einführung der Schulsozialarbeit 1999 wurde vom Land noch ein Drittel finanziert, damals versprach man sogar eine Vergrößerung dieses Anteils. Es ist dann anders gekommen. Das führt dazu, dass Städte wie Konstanz, die nicht über viele potente Unternehmen als Gewerbesteuerzahler verfügen, Schwierigkeiten haben, die Schulsozialarbeit zu finanzieren.
Die Stadtverwaltung hat 2022 in einer Vorlage für den Gemeinderat stolz darüber berichtet, dass im Schuljahr 2019/20 der Landkreis Konstanz nach Freiburg die zweitbeste Versorgung mit Schulsozialarbeiter*innen in Baden-Württemberg aufwies (hier finden Sie das entsprechende Dokument). Dies hat sich nach aktuelleren Zahlen aus dem Schuljahr 2022/23 relativiert, da andere Landkreise nachgezogen haben. Der Landkreis Konstanz liegt auf dem siebten Platz von 44 Stadt- und Landkreisen. Im Landkreis Konstanz kamen im Schuljahr 2022/23 auf eine Vollzeitkraft 573 Schüler*innen, im Landesschnitt waren es 623 Schüler*innen. Diese Daten hat der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) erhoben. Es geht jeweils um den gesamten Landkreis – also nicht nur um den Verantwortungsbereich des Sozial- und Jugendamts der Stadt Konstanz, sondern auch um denjenigen des Kreisjugendamts in Radolfzell, das für die anderen Gemeinden im Landkreis zuständig ist (die Publikation des KVJS finden Sie hier).

Arbeitsbelastung und Vertrauen der Schüler*innen
Aus der Kämmerei – dem für Finanzen zuständigen Amt der Stadt – ist zu hören, Konstanz habe unterdurchschnittliche Einnahmen, könne sich also überdurchschnittliche Ausgaben für Schulsozialarbeit nicht leisten. Die beiden Fachleute aus dem Sozial- und Jugendamt reagieren im seemoz-Gespräch auf diese Argumentation spürbar mit Unverständnis. Christine Moll berichtet aus der Praxis von der hohen Arbeitsbelastung. Bei einer Stellenkürzung müsste theoretisch eine Priorisierung nach dem Kriterium Kindeswohlgefährdung erfolgen. Sie schildert ein Beispiel aus der Praxis, um deutlich zu machen, wie schwierig eine Priorisierung bei der Einzelhilfe in Bezug auf Kinder ist. So habe sie sich Zeit genommen, mit einem Schulkind gemeinsam den Tod seines Hamsters zu betrauern. Objektiv mag dies wenig prioritär erscheinen, aus der Sicht des Kindes stellt sich dies anders dar. Christine Moll sagt, dass Schulsozialarbeit an den Schulen über Jahre erfolgreich etabliert wurde, sodass sich Kinder und Jugendliche häufiger mit ihren Problemen vertrauensvoll an die Schulsozialarbeit wenden.
Markus Schubert verweist auf Herausforderungen, die sich insbesondere für den „Allgemeinen Sozialen Dienst“ (ASD) des Jugendamts ergeben, die aber auch für die Schulsozialarbeit relevant sind. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen nimmt in Konstanzer Familien die Zahl der Multiproblemkonstellationen zu. Dies bedeutet, dass Sozialarbeit sich nicht auf einen Aspekt konzentrieren kann, sondern mehrere Probleme wie finanzielle Belastung, unzureichender Wohnraum, häusliche Gewalt sowie Sucht gleichzeitig auftreten.
Berufsbiographische Hintergründe
Im Gespräch mit seemoz zeigen sich Übereinstimmungen in der Berufsbiographie der beiden Gesprächspartner*innen. Sie haben das Abitur jeweils über den zweiten Bildungsweg erworben und dann Sozialarbeit studiert. Markus Schubert ist gelernter Industriekaufmann, „total langweilig“, wie er rückblickend sagt. Über den damals 18-monatigen Zivildienst kam er in den sozialen Bereich. Er arbeitete als Berufseinsteiger in Frankfurt am Main mit sogenannten „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“, die über den dortigen Flughafen nach Deutschland kamen. Schubert zog 2006 nach Konstanz und war dort zunächst als Sozialarbeiter für den ASD tätig. 2012 übernahm er die Funktion eines Abteilungsleiters. In dieser Tätigkeit ist ihm der Bezug zur herausfordernden Praxis der Sozialarbeit wichtig, die er aus seiner beruflichen Biografie genau kennt.
Christine Moll hat Arzthelferin gelernt und schließlich ein „Duales Studium“ der Sozialarbeit in Villingen-Schwenningen absolviert. Sie war acht Jahre an der Gemeinschaftsschule Gebhard tätig und wechselte vor kurzem an die Gemeinschaftsschule Lotte Eckener am Zähringerplatz. Aus ihrer Erfahrung heraus kann sie Schüler*innen an der Gemeinschaftsschule in Bezug auf die schulische und berufliche Biographie sagen: „Hey, es ist noch alles möglich.“ Markus Schubert betont die Bedeutung der städtischen Sozialarbeit: „Wir organisieren hier soziale Gerechtigkeit für junge Menschen, bei denen nicht der Weg des Akademikers vorgezeichnet ist. Wir können helfen, dass jemand seinen Begabungen entsprechend doch seinen Weg macht, dass Konflikte geklärt werden und Unterstützung geboten wird.“


Schreiben Sie einen Kommentar