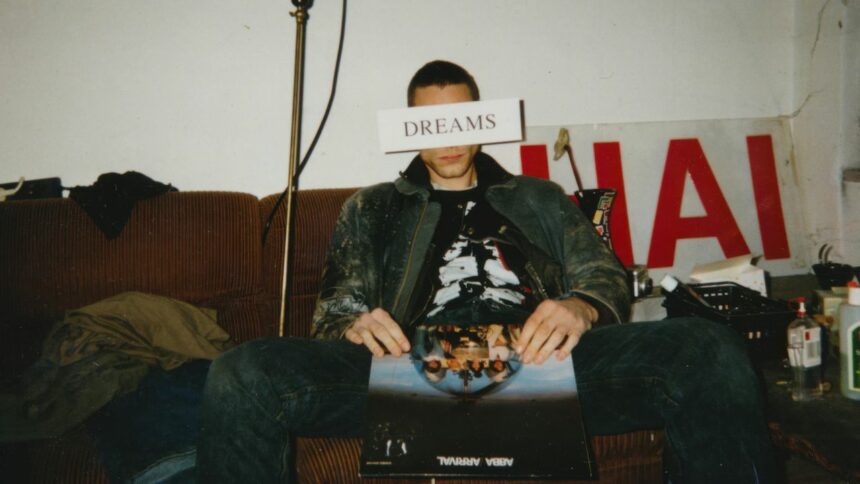
Manuel Stettner präsentiert seinen Dokumentarfilm über den letzten männlichen Nachfahren der durch den Gründer des Rosgartenmuseums, den Apotheker Ludwig Leiner, bekannten Konstanzer Familie Leiner. Der Film über Markus Konradin Leiner ist am 4. November im Zebra Kino zu sehen.
Eine kurze Zusammenfassung des kurzen Lebens von Markus Wolfgang Konradin Leiner, der sich selbst QRT nannte (vielleicht auch einfach ‚Kurt‘ und das Unlesbar-Technoid-Martialische kam dann posthum, man weiß es nicht so genau), könnte lauten: hochintelligent, hochgebildet, schön und sportlich, total verkorkst, exzentrisch und exhibitionistisch. Läuft auf Hochtouren – manche vermuten: flieht aus einem Gehäuse von Eliteanspruch, biographischen Erwartungen und südwestdeutscher Provinzialität –, tobt dann zehn Jahre lang in Seminarräumen, Kneipen, auf Konzertbühnen und in Obdachlosenunterkünften auf Maximalgeschwindigkeit durch das Berlin der Wendezeit (1986–1996), um schließlich – bewusst oder versehentlich, da gibt es unterschiedliche Interpretationen – an einer Überdosis Heroin zu sterben. Er ist in Konstanz beerdigt. Auf seinem Grabstein steht „egal“.
„Okay, noch mehr Texte“
Zu Beginn des Films von Manuel Stettner arbeitet sich eine hochgewachsene Männerfigur mit kahl geschorenem Schädel aus einem Rauschen aus schwarzweißem Kathodenröhrengeflimmer und atemlos aufgezählten Mediendefinitionen heraus. Sie steht auf einer Bühne, um sich herum Musikerinnen. QRT ist der Frontmann dieser Band und singt (oder schreit) von Gewalt, Schmerz und Angst: „diese Qualen waschen Dich rein von allem Schmutz“. Dem Lärm folgt die Stille der Archivalien: das erste Filmbild, das nicht selbst Dokument ist, zeigt nummerierte Pappkartons und führt den Leiter des Merve-Verlags, Tom Lamberty, einen engen Freund von QRT, als dessen Archivar ein. Wir sehen ihn in Kästen, Aktenordnern und Papieren kramen: „Das ist das Zeug, was in der Wohnung noch war.“ Aus einer Plastiktüte holt er ein lose fadengebundenes Konvolut von Papieren mit einer Zeichnung auf dem obersten Blatt. „Okay, noch mehr Texte.“ Kurz bleibt er bei einer Fotografie hängen, um dann weiterzuwühlen. Lamberty erzählt von den posthumen Publikationen – fünf sind es insgesamt – der Texte QRTs: „Es war die Idee, einen Querschnitt zu machen, wobei das nicht thematisch gegliedert werden sollte. Es ging erstmal darum, fertige Texte zu finden.“

Ich erinnere mich noch gut daran, wie die beim Soziologen Dietmar Kamper eingereichte Magisterarbeit QRTs, „Drachensaat“, im Jahr 2000 als schwarz-weißer Ziegelstein mit schwarzem Seitenschnitt, Hardcover, ganz untypisch für Merve, der ja eher für die kleinen, hosentaschentauglichen quadratischen Theoriebändchen bekannt war, auf der Buchmesse in Frankfurt ihren Auftritt hatte. Da wurde was von ‚Szene‘ und ‚hipp‘ geraunt und, naja, ich dachte, das müsse ich wohl haben. Nahm das Buch mit, guckte mal rein, fing an es zu lesen, aber der Text stieß mich in seinem so apodiktischen wie unbelegt-thetisch daherkommenden Gestus ab. Rechte Theoretiker – Carl Schmitt, Ernst Jünger, und, immer grüßt das Murmeltier, Martin Heidegger – zu lesen, war in den 1990er Jahren modisch geworden unter linken oder als ‚links‘ gelesenen Medientheoretikern (die vielleicht ja gar nicht so links waren, wie ich damals dachte). Dabei ging es dann vielleicht sogar eher um einen gewissen metallischen Glanz elitärer Härte oder deren Simulation. Und weil man ja eh ‚links‘ war, durfte man natürlich auch ‚rechts‘ lesen, weil man ja nicht in Gefahr stand, für ‚rechts‘ gehalten zu werden oder sich selber zu halten.
Elitäre Härte oder deren Simulation
Nun ja. Es dauerte, bis ich das Buch wieder zur Hand nahm. Inzwischen konnte ich das mir daraus entgegentönende Theorierauschen besser verstoffwechseln und distanzierter betrachten. So distanziert wie das eigene Suchen nach einer Position. Und als solches konnte ich es selbst und auch die anderen vier Bände, jetzt wieder mervetypisch klein, quadratisch und schnell auseinanderbrechend, nehmen und reflektieren. Und konnte auch das Bedürfnis sehen, das zwischen den Zeilen zum Ausdruck kam, kurz, ich las die Texte nunmehr als Symptom.
Den elitären Gestus, der sich zwar über alles als überkommen und bürgerlich Gelesene hinwegsetzte, vor allem und gerade durch die Inklusion und theoretisch gewitzte Würdigung von Popkulturellem und explizitem Trash, aber dem Habitus, einfach klüger zu sein als alle anderen nicht entkommen konnte, den konnte (und wollte) ich nun verstehen als einen Ausbruchsversuch aus der Provinz. Durch den Grießbrei traditionellen Bildungsgutes hatte man sich durchgefressen und kam nun auf der anderen Seite an, aber hungrig, so hungrig.
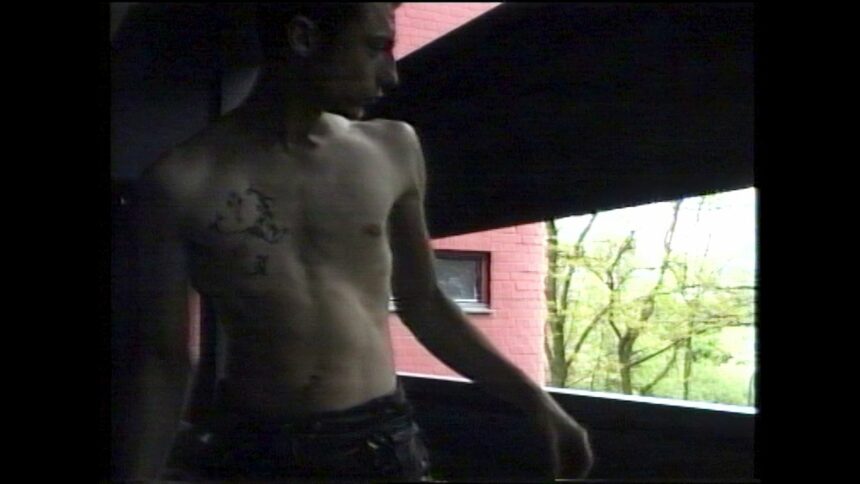
Was ist das?
Und genauso verstehe ich auch die Performance in der (damals noch so genannten) Hochschule der Künste, die von mehreren Freunden QRTs im Film ausführlich erinnert wird: QRT kommt im Anzug mit Aktenkoffer auf die Bühne, es laufen Werner-Herzog-Filme ohne Ton, es läuft Avantgarde-Musik – explizit werden Krzysztof Penderecki und Hans-Werner Henze genannt, also nichts, was man einfach mal so hört oder gar genießt. QRT trägt Gedichte vor, lässt sich von einer jungen Frau – tatsächlich oder gespielt, wer will’s heut noch sagen – einen blasen und entleert – tatsächlich oder gespielt, auch das entzieht sich – coram publico seinen Darm, steht nackt vor’m schockierten Publikum. Das ist – einerseits – wirklich 1990er Jahre, mehrfach übereinander geschichtete Iterationsschleifen heterogensten Materials, dessen posthistorische Gleich-Gültigkeit von einer nur (noch) körperlich einzulösenden Authentizitätssehnsucht konterkariert wird. Und selbst die ist eben nicht mehr einlösbar: Ist das nun tatsächlich Sperma? Ist das wirklich Kot? Und die herumgereichte Bruchschokolade … – „Man wusste nicht, ist das jetzt Schokolade oder was anderes?“
Ja, das ist gleichzeitig extrem – was meint man mit diesem Wort eigentlich? –, aber eben auch durchaus klug, vielleicht brillant – auch hier: mit welchem Maßstab gemessen? (Die Antwort auf die Maßstabsfrage richtet sich stets an den Performer selbst: er muss ja sich selbst überzeugen.) Aber, wenn Oskar Roehler, der dabei war, sagt, dass er die Performance „wirklich beeindruckend“ fand, dann glaube ich ihm das. Und dennoch ist es auch irgendwie sehr, sehr kindlich. Mir fällt neben all den harten Männertexten ein ganz anderer Buchtitel ein: „Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst“ von Alice Miller.
Flucht in die Künstlichkeit
Manuel Stettner lässt jedoch nicht nur Zeitzeugen zu Wort kommen, sondern auch QRT in seinen Texten. Immer wieder stellt er dem historischen visuellen Footage, das so daherkommt, wie es eben ist, und den fast überscharf kontrastreichen Schwarz-weiß-Aufnahmen, mit denen er seine Interviewpartner zeigt, knallbunte Bilder gegenüber. Über diesen Bildern werden Zitate aus Texten von QRT gesprochen. Bilder und Ton sind KI-generiert. Ich bin kein großer Freund von KI, aber mich hat dieser Einsatz rundum überzeugt. Die Tonspur ist auf Basis von historischem Audiomaterial mittels fünf verschiedener Audio-KIs hergestellt worden. So spricht QRT und tut es doch gleichzeitig nicht. Es ist gewissermaßen die umgekehrte Bewegung der eben geschilderten Performance: eine Flucht in die Künstlichkeit, die dem Schmutz des Authentischen nicht entkommt.

Ganz genau simulieren, meinte Manuel Stettner, ließe sich die Stimme QRTs ohnehin nicht, die KIs hätten alle ganz unterschiedliche Fehler gemacht. Aber statt nun zu versuchen, diese Fehler gewissermaßen gegeneinander wegzurechnen und so etwas authentisch Anmutendes zu erzeugen, verstärkt Stettner die Fehler noch manuell mit dem Ziel, eine gezielt künstlich anmutende, aber immer noch an QRTs Stimme gemahnende Audiospur zu erhalten. Das hat dann tatsächlich etwas ‚Untotes‘, Zombiehaftes, ein entleertes, bloß noch simuliertes Leben – man darf gerade bei der Figur des Zombies nie vergessen, dass diese sich vor allem durch ein fehlendes Gehirn sowie einen massiv von Verwesung gezeichneten Leib auszeichnet. Darin unterscheidet sie sich massiv von anderen Untoten – etwa Vampiren.
Der Zombie
Die KI-Bilder Stettners arbeiten sich genau an dieser Art der Körperlichkeit ab. Zombies sind bloße Oberflächen: „Den Zombie sieht man nicht im Spiegel, sondern auf Leinwänden, Bild- und Videoschirmen.“ Massenmediale Bilder letztlich, basierend auf exotistisch fantasierender Heftchenliteratur für Haiti besetzende GIs. Das Körperinnere, das sie zeigen, reicht bloß skin deep, das schneidende Messer kommt nicht unter die Haut der Bildschirme. So ist es gleichzeitig ein Wunsch nach direkter ungefilterter, ja, unwiderlegbarer Körperlichkeit, der den Zombies selbst eignet – sie fressen ja tatsächlich Fleisch – und von ihnen verkörpert wird, als auch die völlige Unmöglichkeit, eben diesen Wunsch zu erfüllen.
Sehr konsequent beginnt Stettner seine dokumentarische Suche nach QRT mit Zitaten, die Gewalt als Durchdringung zweier Körper, als Überwindung zwischenkörperlicher Grenzen definieren. Man sieht etwas Glibbernd-Kugeliges, das sich verzweigt, öffnet, spaltet, an Körperöffnungen erinnert, etwas ab- oder ausscheidet, hügelig metastasiert. Der Schnitt wird zum Bild/Schirm, auf dem Leiber erscheinen – Tiere, Tiermenschen, Menschen, ungetrennt vereint, ineinander verkeilt, in der möglichen Unmöglichkeit der Überwindung von Distanz befangen.
QRT stellt die These auf, man könne die Gegenwart nur beschreiben, wenn man den Mensch durch den Zombie, die Anthropologie durch eine Zombologie ersetzt.
Substanz dieses Denkens
Am 4. November um 21 Uhr wird der Film „QRT. Zeichen Zombie Teqno“ im Zebrakino gezeigt. Im Anschluss daran stellen sich der Filmemacher Manuel Stettner, die an der Universität Konstanz lehrende Philosophin Andrea Lailach-Hennrich und, moderierend, der Literatur- und Medienwissenschaftler Albert Kümmel-Schnur dieser These. Denn was von QRT bleibt, sind ja, neben den Erinnerungen derer, die ihn persönlich gekannt haben, die veröffentlichten wie unveröffentlichten Texte und Zeichnungen – nebst ein wenig Audio- und Videomaterial. In der Diskussion wollen wir prüfen, ob QRTs Thesen heute noch tragen (oder ob sie je getragen haben). Was also ist die Substanz dieses Denkens jenseits der Exzentrizität des Lebens dieses Denkers?
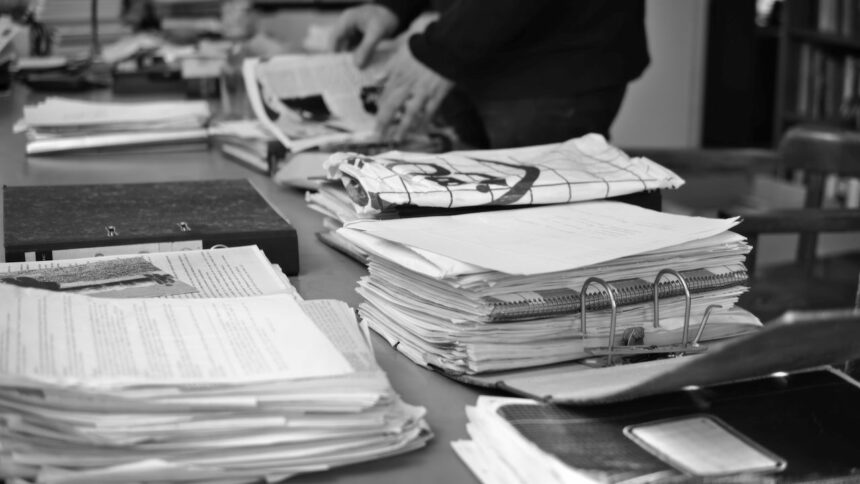
Ein Denken nach dem Menschen und über den Menschen hinaus hat ja seit dem berühmten Satz des französischen Philosophen und Historikers Michel Foucault, dass der Mensch verschwinden werde „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“ Konjunktur. Ging es Foucault um historische Wissensformationen – also keineswegs um die Behauptung, Menschen als Lebewesen würden plötzlich aufhören zu existieren –, dann sind in seiner Folge doch auch radikalere Positionen diskutiert worden.
Die philosophische Anthropologie hat „den Menschen“ (im Kollektivsingular) und „Menschen“ (im Plural) immer zwischen dem Göttlichen, dem Tierischen und dem Maschinellen verortet. Im Zuge des Aufstiegs dessen, was man ‚Künstliche Intelligenz‘ nennt, hat man die apokalyptischen Ängste vor einem, nunmehr durchaus real gedachten Untergang von Menschen, der Robotik- und Alienfiktionen der Literatur und des Kinos schon lange befeuert, aktualisiert. Jenseits solcher Verschwindensängste gibt es aber auch Szenarien der Koexistenz von Menschen mit anders-als-menschlichen Wesen. Die maschinellen Wesen stellen in diesen Vorstellungen nur eine Variante des Anders-als-Menschlichen dar. Und vielleicht ist angesichts des Klimawandels und der erwartbaren Energieknappheit das Maschinelle oder gar Programmierte ohnehin nicht unsere langlebigste Sorge.
Vielleicht hat QRT durchaus recht mit der Annahme, es bräuchte zum Denken dessen, was er noch unter der Figur des ‚Zombies‘ zusammenfasst, einen anders-als-europäischen Blick.
Wir freuen uns auf alle, die am 4. November ins Zebrakino kommen, um mit uns zu diskutieren. Wer sich einen Eindruck von dem machen möchte, was sie oder ihn erwartet, kann sich den Trailer zum Film hier ansehen.

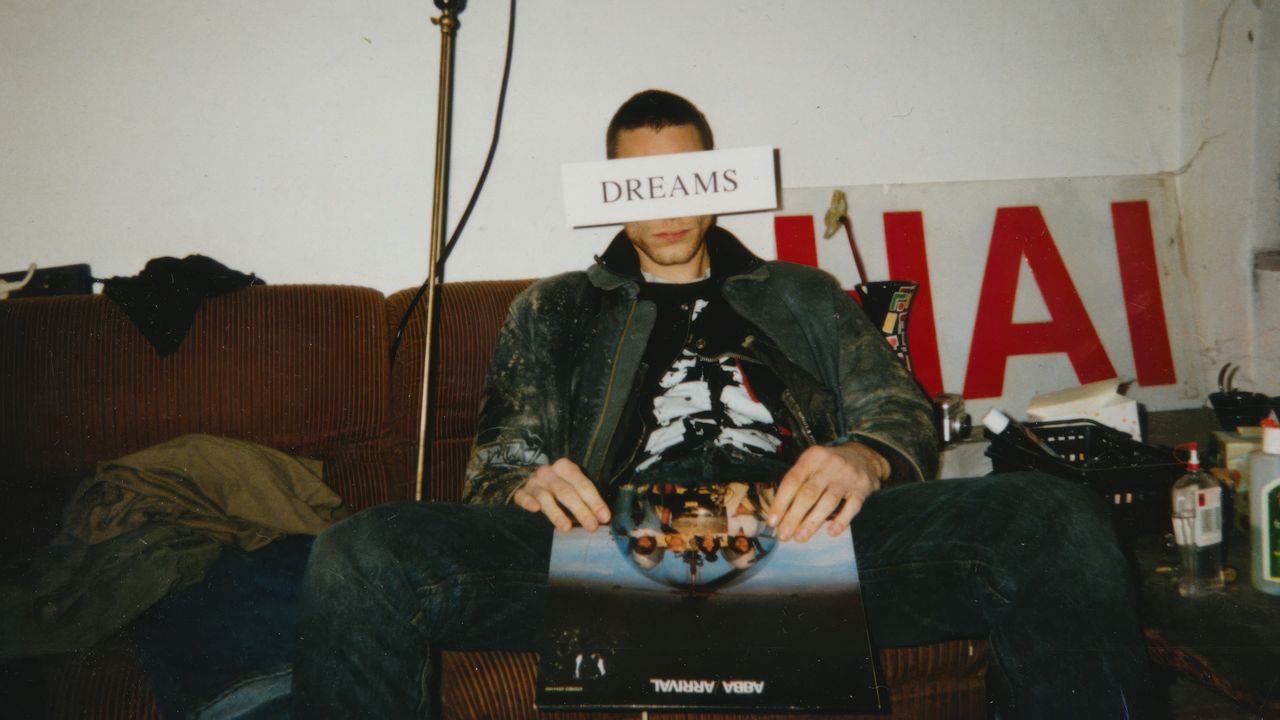
Schreiben Sie einen Kommentar